Spaziergang mit dem Vater, gemeinsam sehen sie Athleten beim Training zu. Hein stemmt 30 kg. Er stellt sich schützend – mit erhobenem Schürhaken – vor die Mutter. [1889]
Hein trat mit Lorenz auf das gegenseitige Rheinufer. Schön fand er es, neben dem Vater zu spazieren. Sprach er auch kaum ein Wort mit ihm, so war es immerhin eine Anerkennung. Der Titel „Alter“ erhielt dadurch auch einmal einen Sinn in angenehmer Hinsicht. Besondere Vorstellungen hatte er dabei zwar nicht, was ja bei der Wechselhaftigkeit der Launen des Vaters zwecklos war. „Ich mache mit dem ‚Alten‘ mal einen Spaziergang“, hatte dieser zur Mutter gesagt.
Sie begegneten vielen promenierenden Menschen, überquerten Straßen und Plätze, die vom Glockengeläute vieler Kirchen wiederhallten, deren Turmspitzen hier und da an Kreuzungen erinnerten und über den Dächern das Auge auf sich zogen.
„Ach, wir können mal da hinunter gehen“, entschied sich Lorenz endlich. Sie traten in eine Wirtschaft. Zwischen Athletenbildern stand ein Schrank mit einer verglasten Tür, hinter der blanke Trinkhörner und Pokale prangten, die Hein mit Blicken verschlang. Der Inhalt eines Henkelglases verschwand hinter den Lippen des Vaters, als sei er eingesogen worden, dann fühlte er sich geschoben, es ging am Schanktisch vorbei über einen Hof in einen kleinen Saal.
„Oh!“, entschlüpfte es Hein. In einem Viereck verblichener gestrichener Wände standen Männer in Schwimmhosen und Athletentrikots, zu ihren Füßen Hanteln und Gewichte, wie er sie bei Abs gesehen, ringsum Männer in Straßenkleidern. Der Boden, der fingerbreite Lücken zeigte, erdröhnte eben unter der Gewalt einer abgeworfenen Hantel. Im Hintergrunde rangen zwei Athleten. Was mochte den Vater bewogen haben, mit ihm hierher zu gehen? Etwa seinetwegen? Dann möchte er ihm vor allen Leuten an den Hals springen.
Lorenz las des Jungen Gedanken. „Hier habe ich vor Jahren eine Reihe Athleten geworfen“, klärte er ihn in lakonischem Ton auf, was dessen Spannung noch steigerte.
„Warst Du auch Athlet, Papa?!“
„Ach was, ich war gerade mal hier!“
Heins starrende Augen wurden zu Griffen, an denen er sich an der Gestalt des Vaters hochzog, der, dies kaum beachtend, rüstig in eine Gruppe der Übenden schritt, um Einzelne zu begrüßen.
Hein sah aber jetzt nur den Vater. Wie war das denkbar? Papa warf Athleten, ohne selbst Athlet zu sein?! Warum ist er kein Athlet geworden? Ist er nicht stolz, fand er das nicht schön? – Kam der Vater, auch nur einer zufälligen Eingebung folgend, mit ihm hierher, sollte er nicht versuchen, daraus zu gewinnen? Er würde wohl auch ihm gestatten, sein Können zu erproben?
Wie sollte er es nur beginnen? Diese schwarzen, runden und zylindrischen Gewichte mit den glatten Griffen; wie leicht musste es sein, sie zu heben. Er dachte an den klobigen, scharfkantigen Pflasterstein, der so oft Schmarren auf seiner Haut hinterließ. „Au jetzt!“, entschloss er sich, als der Vater eine Einladung zum Heben abschlug: „Papa, darf ich mal?? Papa?!” Lorenz sah ihn belustigt an: „Was kannst Du denn schon?“ Es klang beinahe abfällig, da Hein noch zögerte: „Nun mach schon!“
Hein lief an die Wand, die Gewichte zu prüfen. Wie schön sie sich greifen ließen. Er holte eins mit der rechten Hand zur Schulter, stellte die Beine auseinander, drückte es hoch. „30 Pfund“, meldete er dem Vater. „Das geht schon“, lobte dieser, was Hein ermunterte: „Ich kann noch mehr.“
So wurden die Athleten seiner gewahr. „Hierher, Junge!“, kam es aus der Gruppe. „Wir wollen auch etwas sehen!“
Hein sah sich umringt, als Mittelpunkt unter Fachleuten. Warmes Grieseln kroch vom Nacken hoch, über das ganze Gesicht. Hätte ich lieber nicht angefangen, keimte die Scham in ihm. Nur Augenblicke, und sie war unterdrückt vom Willen, etwas zu zeigen.
40 Pfund brachte er hoch. Ein Athlet holte 50, nahm ihm den Rock ab: „Ran! Junge!“ Wie gezogen ging das Gewicht in die Höhe.
„Na?!“, staunte Lorenz: „Nun ist’s genug!“
Im Kreis erhob er sich schmunzelnd: „Ohne Übung!“
„Sieht man dem Knirps gar nicht an!“
„Sehr nett!“
„Wie alt ist er denn?“
„Im Mai werde ich vierzehn Jahre.“ Stolz lachte Hein die Großen an: „Die Dinger kann man so schön anfassen!“, sein langer Blick traf auch den Vater: „Papa, ich kann aber noch mehr!“
„Hier!“, stellte ihm einer ein Kugelgewicht von 30 Kilo hin. In Lorenz war der Stolz geweckt. Man lobte seinen Sohn. Man traute ihm etwas zu: „Wenn Du das schaffst, kriegst Du einen Taler!“
Das traf Hein wie einen elektrischen Schlag. Seine Gedanken flohen für Sekunden nach Mühlberg ins Warenhaus Feinhals: – Was wünschen Sie, junger Mann? – Ich möchte ein Paar Turnschuhe, ein Turnhemd und eine Turnhose. –
Lorenz wurde es unter dem dankbaren Blick des Kindes weich ums Herz: „Nun mach, Alter!“
Die Bedeutung des Talers ermessend und die Schwierigkeit seiner Gewinnung würdigend, schwiegen die Umstehenden zunächst. Erst als Hein vor dem Niederbeugen die Runde abstreifte, ermunterte man ihn: „Fass gut an!“
„Klar, der Taler ist Dein!“
„Los, Ruck!“
Schwer kam die Kugel zur Schulter. Verwundert beachteten die Männer das ungelenk vorgesetzte Bein, dessen Knie viel dicker war als die Wade, den noch leicht gebogenen Arm, der auf Bruchteile einer Sekunde gelähmt schien; das Gesicht des Jungen, das hart und finster wurde, als gelte es, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen.
Hein keuchte: „Aeh!“ Oben war‘s!
„Fein!“
„Bravo!“
„Großartig, Junge!“, applaudierten die Athleten dem Sieger, der noch nicht zufrieden war: „Ich möchte noch mehr können“, worauf ihn schallendes Gelächter umfing.
Hein hörte noch, wie jemand zum Vater sagte, aus ihm könne mal etwas werden: „Er hat einen starken Willen“, dann eilte er in Gedanken mit dem Taler, den er heute noch, wohl schon in Minuten, besitzen würde, weit voraus.
* * *
Der niedrige Hügel Kleinholz im Garten, vor dem Hein, emsig hackend, saß, wuchs langsam an. Je mehr er sich erhöhte, umso mehr steigerte sich seine Lust. Erschien ihm doch dieses Tun als eine kräftigende Übung, denn er schwitzte schon und musste tief Atem holen. Es deuchte ihm, dass die anhaltende Anstrengung wohltue und daher dem Körper irgendwie förderlich sein müsse. Allerdings, nachher würde die Ermattung kommen. Nun, es ging ja auf den Abend zu und morgen war Sonntag.
Zuhause schlug knallend eine Tür. Die herrische Stimme des Vaters schaltete sich in das Tacken des Beils ein. Abgerissene Worte der Mutter klangen schwach durch, allerdings lauter werdend.
Von der Wiese kamen die Geschwister, schleichend zu horchen.
Geklirr zerbrechenden Steingutes, begleitet von einem Aufschrei der Mutter, ließ sie den Atem anhalten.
Hein fühlte, dass ihm heiß wurde, sprang auf, in die Küche, sah in deren Mitte den wild gestikulierenden, brüllenden Vater; vor der Anrichte, wie in Erwartung von etwas Furchtbarem Mathilde starr mit stolzer drohender Miene, hinter der, selbst für Hein erkennbar, namenlose Angst saß.
Eins beherrschte ihn: Ich muss helfen! Dann brach das Denken ab, er stand plötzlich, mit hochgeschwungenem Feuerhaken, dem Vater gegenüber.
„Mein Gott!“, stöhnte Mathilde entsetzt auf, verzweifelt gegen die anschleichende Schwäche kämpfend: „Hein!“
Ein Unglück musste geschehen! Und sie konnte nicht eingreifen. Bei jeder unbedacht ausgelösten Bewegung konnte dem Manne der Feuerhaken ins Auge fahren. In der nächsten Sekunde musste Lorenz den Jungen wie einen Strohmann zusammenschlagen.
In der Tür drängten sich jammernd die Geschwister. Nettchen irrte, um Hilfe rufend, im Garten umher.
Mathilde aber sah nur den Mann und ihren Sohn, die, es dünkte ihr eine Unendlichkeit, sich wie Steinfiguren unbeweglich anstarrten.
Heins Kopf reichte gerade an des Vaters Schultern. Kreideweiß im Gesicht, begriff er jetzt die Ungeheuerlichkeit des Geschehens, wie auch die Unmöglichkeit eines Rückzuges. So blieb er mit verbissenem Blick, doch in männlicher Entschlossenheit stehen.
Lorenz trat mit entspannt hängenden Armen einen Schritt rückwärts. Seine geröteten Augen hefteten sich suchend auf Hein, wobei die Brauen sich zusammen- und wieder auseinanderschoben. War das sein Sohn? Nein, dafür kam er ihm zu groß vor, und das da war ja auch kein Kind. Aber es war in der Küche, dann musste es auch sein Sohn sein. Richtig, da stand Mathilde, die sah auch so komisch aus. Blitzschnell jagten die Gedanken; Lorenz vermochte sie nicht zu meistern. Der da vor ihm stand, hielt etwas in der Hand, wozu er hinaufschauen musste. Er war doch nicht gewöhnt, zu etwas hinaufzuschauen. Er empfand Respekt vor ihm. Aber wenn das sein Sohn war, der da, mit den Augen, die brannten wie glühende Kohlen, warum stand er so da?!
Lorenz führte langsam die Hand zur Stirn, rieb sich die Augen und kehrte sich um zum Flur, sich schlüssig werdend, das Unklare nach einem Stündchen Schlaf noch einmal zu überlegen. Wofür war er denn zu Hause? Um seine Ruhe zu haben. Also. Die Treppe knarrte laut vernehmlich unter der Last, die Lorenz ihr aufgab.
Mathilde umarmte herzlich den auf sie zustürmenden, schluchzenden Hein, gleichzeitig scheltend: „Junge! Nie darfst Du die Hand gegen Deinen Vater erheben!“, sofort auch erkennend, dass er sie jetzt nicht verstehen werde.
„Mein guter Hein!“ Unter dem Berge von Schmerz, der sie bald ersticken müsse, glimmte ein Fünkchen Freiheit. Er wird mein Beschützer sein. In seiner Gegenwart wird der Vater sich fortan bezähmen müssen. Es ist gut, dass ich bei den Kindern ausgehalten habe.
Bang schoben sich die andern gegenseitig durch die Tür.
„Wo ist Johann?“, weinte Nettchen.
An ihnen vorbei rannte Hein in den Garten. Es sah aus, als werfe er sich aus Übermut in das Gras. Nettchen, die ihm folgen wollte, wurde von der Mutter zurückgehalten: „Lass ihn jetzt.“
„Er hat sicher Angst vor Papa, vor morgen!“, ängstigte sich Nettchen.
Das rief ein siegessicheres Lächeln auf Mathildes Gesicht: „Er wird ihn nicht anrühren!“, sagte sie und wurde wieder hart: „Geht spielen! Vergesst es!“
Im Garten sah sie, dass Hein sich im Weinkrampf wälzte.
Fest klammerte er sich an die Grasbüschel, immerzu seine Stirn auf der Erde reibend. „Warum habe ich das getan? Wie kam das nur? Ich musste doch etwas tun?“, suchte er sich vor seinem Gewissen zu rechtfertigen. „Mama!“ „Mama!“, keuchte er in einem fort.
Er fühlte, wie sich eine Hand zwischen das Gras und seine Stirn schob. „Mein guter Junge“, hörte er über sich Mathildes Stimme, die so seltsam weich klang.
Das ernüchterte ihn. Willig ließ er sich von Mathilde heben. Als er aber das Zucken in der Mutter Gesicht und in ihre feuchten Augen sah, die zu ihm zu sprechen schienen: „Ich weiß es ja, Du wolltest mir helfen. Du bist gut.“ – Da warf er sich an ihre Brust.
* * *
Hein ging unter einem Giebel, dessen obere Hälfte geteert war, auf einen Zaun zu. Die Hände in den Hosentaschen, stieß er die Brettertür mit dem Fuße auf, trat in einen Hof, der Bierkästen, Tonnen und Kisten beherbergte, auf deren Rändern zum Teil Säcke hingen. Eine Gestalt schien über einer Efeuhecke in der Luft zu hängen, Hein trat hinter ihr unter die Baumkrone, die den größten Teil eines Turnrecks verdeckt hatte. Ringsum standen Bäume und Sträucher, mit Früchten belastet.
Wie ein Knäul wirbelte Johann um die Stange, landete mit elegantem Schwung auf dem Rasen.
Er war etwas kleiner als Hein. Sein zartes ovales Gesicht war stark gerötet. Herausfordernd leuchteten seine stahlblauen Augen zwei gegen die Hecke gelehnte Burschen an; Pille Mappei, ein frischer, froh dreinschauender Bengel, und Fritz Opladen, ein gesetzter Junge mit breitem, knochigem Gesicht.
„Schön!“, sagten beide wie aus einem Munde.
„Es macht hier doch mehr Spaß, wie an dem alten Ding auf dem Schulhof“, freute sich Johann. „Und der Staub immer.“
Dass Hein den Rock auszog, war Signal zum Wettkampf. „Ich möchte Dir direkt was schenken, Fritz“, sagte er mit Andacht: „Weil Du das schöne Reck hast.“
Der aber wehrte ab: „Du bist ja dumm. Das ist für uns alle.“ Hein hatte Verlangen nach Kraftübungen: „Ihr habt ja schon geturnt.“ Sprang an die Stange, zog die Beine an, steckte sie zwischen die Arme hindurch nach hinten.
„Eins“, „zwei“, „drei“, „vier“ bis „sechzehn“ zählten die anderen. Der Reihe nach versuchten es die Freunde. Fritz Opladen kam ihm mit 12 Sekunden am nächsten. Er war zwei Jahre älter als Hein, auch stärker gebaut.
„Schwungstemme!“, gebot er nun, wissend, dass er darin der Bessere sei. Hein kam ihm aber heute gleich. Im Klimmzug übertraf er ihn sogar, was jener aber nicht nennenswert fand: „21 zu 24, das ist doch kaum ein Unterschied.“
„O Freundchen!“, behauptete sich Hein: „Ich habe doch viel längere Arme als Du. Ich muss mich doch viel höher ziehen“, was alle zum Lachen reizte. Sogar der Bruder stand Fritz bei: „Die Stange ist doch für uns alle gleich hoch, wenn wir daran hängen! Jeder muss seinen Körper hochziehen.“
Hein jedoch empfand, dass, wenn man ihn bei jeder Gelegenheit an seine langen Arme erinnerte, dies für manches nachteilig, für vieles auch gut sein müsse. „Siehst Du? Für Ohrfeigen zu geben, sind sie gut. Da sitzt mehr Schwung dahinter.“ Beim Schlagen in die Luft drehte er sich mehrmals um seine eigene Achse.
„Was denkst Du!“
„So was Dummes!“
„Ach, Hein macht ja nur Spaß!“, verteidigte Johann ihn.
So flüchtete Hein sich zu seinem Liebsten: „Wo hast Du meinen Stein?“, wandte er sich an Fritz, der in die Zaunecke zeigte.
Hein hob den Stein wie einen Schatz zur Brust. Es war ein besonders großer Basalt, breit und hoch, mit rechtwinkeligen Kanten und flacher Kuppel. Liebevoll betrachtete er den eisernen Griff, den er mit so großer Mühe einzementiert hatte. Wie gut es war, dass er bei seinen Freunden liegen konnte.
Er stemmte den Stein rechts, dann links, viele Male. Stellte sich breitbeinig, warf ihn hoch, fing ihn wieder auf, mit einer Hand, dann mit beiden zugleich.
„Du schlägst Dir noch die Knochen kaputt mit dem Ding!“, mahnte Pille Mappei.
„Schadet nichts, ich muss noch üben.“ Wie kindisch die Freunde noch waren: Beim Hobeln fallen Späne.
„Das macht ihm nichts. Er ist schon viel gewöhnt“, scherzte Fritz: „Vom Mirakel.“ Da nahm Heins Gesicht männliche Härte an.
Sie legten sich ins Gras. „Du weißt doch, wie ich es meine“, versicherte Fritz nach kurzer Pause, während Pille die Miene Heins zu schaffen machte: „Sag Hein, warum machst Du immer so ein finsteres Gesicht? Auch beim Stemmen immer.“
Hein wusste nicht, wie sie das meinten, hob gleichgültig die Schultern: „Was wisst Ihr vom Ernst des Lebens. Das ist wohl Ärger, weil ich es nicht schnell genug hochkriege“, und sie lachten sich aus vollem Halse an.
„Turnen ist wirklich was Schönes!“, schwärmte Fritz: „Das tut direkt gut, wenn es einem so warm wird und man schnell atmen muss.“
„Das ist wahr“, meinte auch Hein: „Es ist beinah so, als wenn man daran merkt, dass man ein Mann ist!“
Fritz wollte hell auflachen. Sie waren doch noch lange keine Männer. Er bedachte aber, dass Hein durch das schlechte Leben zu Hause ja immer gleich an ernste Sachen denken musste. Aber wissen, man wird mal ein Mann, das war ja auch schön: „Denkst Du Hein?“
„Sicher! Darum ist wohl auch das Turnen erfunden worden.“
„Darum?“ zweifelte Pille noch.
„Doch“, erklärte Johann: „Jahn[1] hat das Turnen erfunden, damit wir stark werden. Napoleon unterdrückte Deutschland, und Jahn sagte: ‚Wir müssen gesund und kräftig werden, damit wir die Freiheit wiedererringen können.‘ Das lernen wir jetzt gerade in der Schule.“
„Sowas hat uns der Lehrer auch erzählt“, erinnerte sich Pille: „Schon Iange her. Das ist ja auch egal.“
„Egal?“, protestierte Hein.
„Ich meine nur, es ist auch so schön.“ Er streckte die Arme aus und presste beim Lachen die Zähne zusammen.
„Jahn wollte das“, sagte Fritz noch sinnend. Der Stoff des Gespräches erinnerte ihn an einen Turnabend, der schon einige Wochen zurücklag. Wie war das doch damals? „Ja“, hob er wieder an: „Das Turnen ist für alle gut. Das sagte so ein Alter, der hatte eine Brille auf. Aus Köln war er. Er hat sich im Turnsaal auf das Pferd gesetzt und wir alle Drumherum. Dann hat er erzählt: Jahn hätte 1811 so angefangen, wie wir es heute machen. Das war am Rande von Berlin in der Hasenheide. Aber sie hatten ganz einfache Geräte und machten dafür mehr Freiübungen. Nachher, als es schon eine große Sache war, hat es Streit deshalb gegeben. Der Alte sagte, Mucker, die Höchsten, die über alles zu bestimmen hatten, die aber nicht verstanden, wie gut es Jahn meinte, verboten das Turnen und ließen die Geräte kaputtschlagen.“
„Ach!“
„Nein, sowas!“
„Schade, die schönen Geräte!“, musste er sich unterbrechen lassen.
Fritz wurde etwas unwillig: „Seid doch ruhig! Sonst vergesse ich alles wieder.“ Es war einige Augenblicke ganz still. Nur das Fass, auf dem Hein sich wiegte, knarrte leise.
Fritz entsann sich wieder: „Ja, und später wurde lange nur in Schuppen geturnt. – Es soll aber auch für Frauen gut sein.“
„Für Frauen?“, staunten seine Zuhörer wie aus einem Munde.
Doch Fritz fuhr ohne Unterbrechung fort: „Früher, vor bald dreitausend Jahren, haben schon die Helenen geturnt, aber ohne Geräte. Sie nannten es auch anders, ich glaube Gymnastik, oder so ähnlich. Und was denkt Ihr wohl? Da haben sogar Götter und Gottinnen gerungen!“

Hein sprang auf: „Götter?! Das ist nicht wahr!?“
Auch die anderen zweifelten. Johann rief: „Es gibt doch nur einen Gott im Himmel!“
„Götzen meinst Du!“, vermutete Pille.
Damit hatten sie Fritz beleidigt. Beschwörend streckte er beide Hände vor: „Ihr könnt es sicher glauben! Ihr könnt den Crämers Paul fragen; der war doch dabei! Die hatten damals da unten noch andere Götter!“ Er maß Pille mit einem überlegenen Blick: „Götzen! Die sind doch aus Holz! Wie könnten die denn turnen?“
„Und Götter haben keinen Körper. Das sind Geister!“, fiel Johann mit gewichtiger Miene ein.
Nun blieb Hein ruhig, mochten sie streiten. Was Fritz erzählte, musste doch irgendetwas Schönes bedeuten. Götter rangen! Wie herrlich sich das anhörte. Grad so, als ob der Kaplan von Heiligen sprach. Dann horchte er wieder, da Fritz erklärte: „Sagen, wie bei uns die Siegfried-Sage.“ Pille sperrte den Mund auf und machte mit langem Gesicht: „Ach so!“
Fritz hätte gern mehr erzählt. Dass alle Kinder in Hellas üben mussten und sogar ein berühmter Gelehrter, Plato, den Frauen gebot, Leibesübungen zu betreiben, weil dann die Kinder schon gesünder als sonst zur Welt kämen. – Aber sie glaubten ihm ja nicht.
Er bemerkte Heins Abwesenheit. Ihm hatte seine Erzählung sicher gefallen. O ja, Hein verstand ihn schon. Bedauernd musterte er ihn: „Weißt Du, Hein, komm doch endlich in den Turnverein. Du kämst sicher bald in die Stammriege.“
„Denkst Du?“, wunderte sich der Gefragte. „Ich habe doch das Geld für Schuhe und Turnsachen nicht.“
„Du kannst doch erst mal so mitturnen.“
„Ach ja! Aber mein Vater schlüge mich halb tot.“
Das machte Fritz nachdenklich: „Aber mal musst Du doch 2,50 Mark oder 3,- Mark zusammen haben. Es geht ja auch anfangs ohne Turnschuhe. Also 1,50 Mark.“
„Das ist doch viel Geld!“, ließ sich Johann vernehmen, wodurch Mappei gereizt einwarf: „Hein muss doch arbeiten!“
„10 Pfennig Sonntagsgeld.[2] Da müsste ich 15 Wochen sparen – wenn ich dafür Hemd und Hose bekomme. Und ob Vater mich in Schuhen mitmachen lässt?“, rechtfertigte sich Hein mutlos: „Es kommt auch oft mal etwas dazwischen, was Geld kostet, mal eine Selter, wenn man großen Durst hat, und mal ein Namenstag. Den Eintritt und Beitrag jeden Monat kann ich doch auch nicht bezahlen.“
Er atmete schwer: „Ja, wenn mein Vater mir den Taler …“, und unterbrach sich, schaute betrübt über die Köpfe der Freunde hinweg.
„Was für einen Taler?“, fuhren sie auf. Da er nicht antwortete und auch Johann den fragenden Blicken auswich, sahen sie finster ins Gras.
In der Befürchtung, er könne sie beleidigen, fuhr Hein fort: „Ich habe kein Geheimnis vor Euch, aber Ihr dürft es keinem sagen.“ Er entschloss sich, ihnen zu erzählen, wie der Vater im Winter mit ihm in der Kölner Athletenhalle war und ihm einen Taler versprach: „Ich hätte es Euch schon lange gesagt, aber wegen des Talers konnte ich es doch nicht.“
Pille und Fritz, die ihn zunächst begeistert angehört hatten, ließen jetzt die Köpfe hängen. „Den Taler hat er Dir wirklich nicht gegeben?“, zweifelte der letztere noch. Als er, sich erhebend, des Freundes betrübtes Gesicht sah, glaubte er: „Hast Du ihn denn nie erinnert?“
„Himmel, bald danach. Da hat er gesagt, er hatte das nur so hingesagt. Was ich mit dem vielen Gelde überhaupt anfangen wollte, hat er gefragt. Ich sagte: Turnsachen. Da hat er geantwortet: ‚Quatsch! Dafür gibt man kein Geld aus!‘.“
„Das ist nicht schön!”, urteilte Fritz mit Nachdruck.
Hein tröstete sich damit, dass er später mehr Sonntagsgeld bekommen werde: „Aber ich komme ab und zu heimlich üben, wenn Ihr mich lasst, ja?“
„Klar, das wäre noch schöner! Und auch in den Pausen üben wir feste weiter.“
Pille ging wütend hin und her: „Sowas! Nein sowas! – Was ist in den Pausen?“, wollte er wissen.
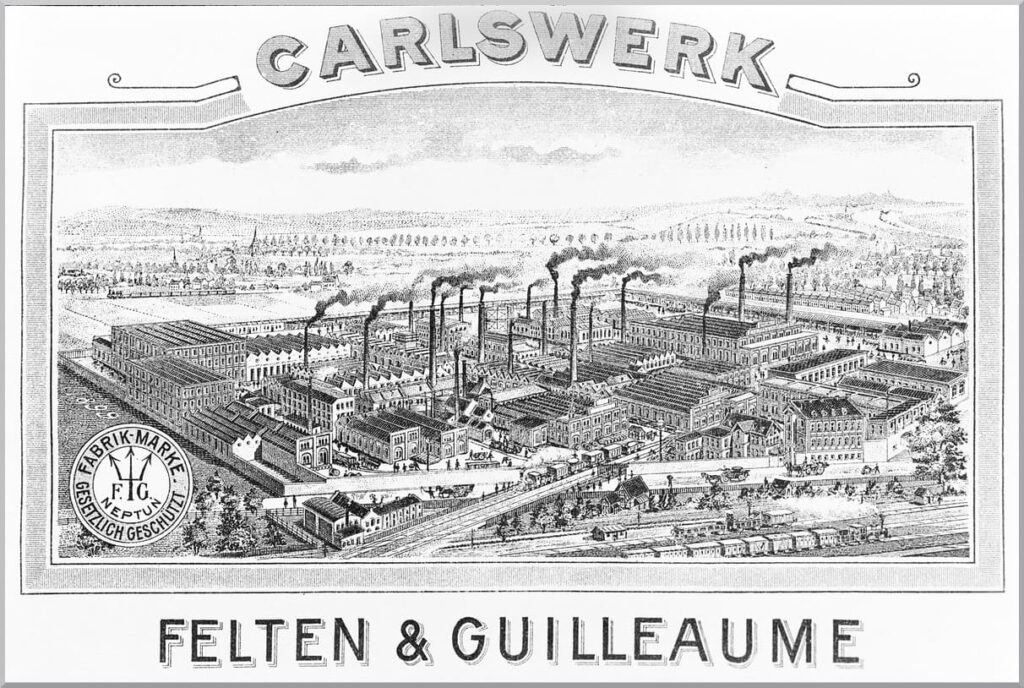
„Ja! Hinten in der Fabrik, vor den Geleisen. Wir ziehen Hanfstricke durch die Haspeln und stecken Eisenbahnräder auf lange Eisenstangen. Das sind 120 Pfund. Eine gewickelte Haspel, so eine kleine, das sind 70 Pfund. Hein stemmt unsere Hantel 8-mal! Mal ist ihm ein Rad abgerutscht und die andere Seite herunter gekippt!“, Fritz lachte laut auf: „Das hat geklungen, sag ich Dir, als ob Glocken geläutet hätten! Da sind auch alle zusammengelaufen!“
„Das ist aber gefährlich!“ Sie gingen gemächlich vom Hofe. Pille Mappei konnte sich nicht beruhigen, nach langem Brüten entrang es sich ihm: „So könnte mein Vater nicht sein. Ein Mann ein Wort! Aber versaufen kann er‘s!“
Da wandte sich Hein mit einem Ruck um: „Pst!“, drückte ihm die Hand auf den Mund: „Sag bloß nichts!“, und entfernte sich mit Johann, der gleich zurückkam: „Sagt bloß keinem etwas!“, und schnell hinter Hein herlief.
* * *
[1] Johann Friedrich Ludwig Christoph Jahn, auch bekannt als Turnvater Jahn (geb. am 11.08.1778 in Lanz [Prignitz]; gest. am 15.10.1852 in Freyburg [Unstrut]). Jahn war ein deutscher Pädagoge, nationalistischer Publizist und Politiker. Die von ihm initiierte deutsche Turnbewegung war mit der frühen Nationalbewegung verknüpft, um die deutsche Jugend auf den Kampf gegen die napoleonische Besetzung vorzubereiten. Das heutige Geräteturnen geht auf das von Jahn begründete Turnen zurück. Von ihm wurden Turngeräte wie das Reck und der Barren eingeführt. Vgl. Friedrich Ludwig Jahn, WIKIPEDIA (online; 22.04.2025).
[2] Bei Sonntagsgeld handelte es sich um ein wöchentliches Taschengeld, das die Kinder zur eigenen Verfügung bekamen.

